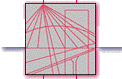|
Rahmenbedingungen
für polnische Ingenieure im vereinten Europa und Deutschland
Thomas
Noebel, Bundesingenieur Kammer
|
 |
I. Europäische
Herausforderungen
Die
EU-Erweiterung ist die
größte Herausforderung, der sich die
Europäische Union
am Beginn eines neuen Jahrtausends gegenüber sieht.
Ein in der
Geschichte
einzigartiger Prozess führt 375 Mio. Europäer in 15
EU-Mitgliedsländern mit den rund 100 Mio. Bürgern in
zunächst zehn Nationen Mittel- und Osteuropas zusammen. Mit
der
Volksabstimmung in Lettland am 20.09.2003 hat auch das letzte der
Beitrittsländer mit einem klaren Ja für den Beitritt
zur
Europäischen Union gestimmt.
Die polnische
Bevölkerung hat am 08.06.2003 mit fast 78 %
überzeugend
für einen Beitritt in die Europäische Union gestimmt.
Polen
hat bereits frühzeitig die mutige Entscheidung getroffen, eine
offene freiheitliche Gesellschaft, eine moderne Demokratie und
funktionierende Marktwirtschaft mit Freien Berufen zu schaffen.
Inzwischen
wickeln die
Beitrittsstaaten zwischen 50 und 70 % ihres Außenhandels mit
den
EU-Ländern ab. Ein Beitritt kann erst erfolgen, sobald ein
Bewerberland in der Lage ist, den mit einer Mitgliedschaft verbundenen
Verpflichtungen nachzukommen und die erforderlichen wirtschaftlichen
und politischen Bedingungen zu erfüllen. Insofern hat Polen
bereits jetzt den größten Teil der von
Brüssel
gemachten Auflagen erfüllt.
Zusammenarbeit zwischen
Ingenieurkammern Europas durch ECEC gestärkt
Die
Zusammenarbeit der
Ingenieurkammern der europäischen Länder muss
verstärkt
und am Ort der politischen Entscheidung ihren Ausdruck finden. Dieser
Ort ist Brüssel. EU-Entscheidungen beeinflussen das
unternehmerische freiheitliche Umfeld der Ingenieure in vielfacher
Weise.
Es ist
für uns eine
große Freude, dass die Bundesingenieurkammer gemeinsam mit
der
polnischen Ingenieurkammer am 26.09.2003 in Wien den so genannten
Europäischen Rat der Ingenieurkammern (ECEC)
mitgegründet
hat. Viele europäische Ingenieurkammern (Deutschland, Italien,
Kroatien, Montenegro, Österreich, Polen, Slowenien, Slowakei,
Tschechien und Ungarn) haben sich auf eine berufsständische
Vertretung der Ingenieurkammern Europas bei den EU-Institutionen
verständigt.
Diese neue Dachorganisation der
Ingenieure bzw. Ingenieurkammern verfolgt folgende Ziele:
- die Wahrung der beruflichen Belange
der
Ingenieure und der Nationalen Ingenieurkammer vom Europäischen
Parlament und der Europäischen Kommission,
- Förderung, Planung und
Begleitung
der Europäischen Gesetzgebung, der Rechtsprechung, der
Verordnung,
der Richtlinien und der Standards,
- Förderung der
Ingenieurausbildung
und der ständigen beruflichen Weiterbildung sowie die
Ausarbeitung
beruflicher Ausbildungsnormen,
- die Schaffung gemeinsamer
berufs-ethischer Prinzipien auf der Basis gegenseitigen
Verständnisses,
- Eintreten für eine
Europäische Gebührenordnung.
Darüber
hinaus wird
sich unser gemeinsamer Dachverband um aktuelle Richtlinien und
Verordnungen kümmern, die den Berufsstand der Ingenieure in
starkem Maße betreffen.
Aktuelle
EU-Richtlinienentwürfe, die für die
Berufsausübung der Ingenieure von Bedeutung sind:
1.
EU-Dienstleistungsvergaberichtlinie
2. EU-Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen
3. EU-Dienstleistungsrahmenrichtlinie
1. EU-nationales Vergabewesen
für Ingenieurdienstleistungen
Etwa 30.000
öffentliche
Auftraggeber kaufen jährlich für etwa 250 Milliarden
Euro
Waren und Dienstleistungen allein in Deutschland ein.
Vergaberichtlinien
der
Europäischen Gemeinschaft verpflichten die Mitgliedsstaaten,
ihr
nationales Vergaberecht so zu verändern, dass eine
transparente
EU-weite Beschaffung möglich ist.
Der
Zusammenschluss der
Europäischen Union und die damit verbundenen
marktöffnenden
Richtlinien haben zu einer Zweiteilung des Vergaberechts
geführt.
Diese
Zweiteilung ist
abhängig vom zu vergebenen Auftragswert. Ist der Auftrag
unterhalb
einer bestimmten Schwelle, gelten die nationalen Vergaberegelungen.
Für
Aufträge
oberhalb des Schwellenwertes gilt eine Mischung aus deutschem und
europäischem Vergaberecht. Dies gilt auch für den
Fall, dass
nur nationale Unternehmen an der Ausschreibung teilnehmen.
Europäische
Schwellenwerte
Folgende
EU-Schwellenwerte ohne Umsatzsteuer sind seit dem 01.02.2001 nach der
Vergabeverordnung gültig:
| Bauleistungen |
5 Mio. Euro |
| Warenleistungen |
200.000 Euro |
| Dienstleistungen |
200.000 Euro |
Gründe für
die europaweite Einführung dieser Schwellenwerte sind:
- Förderung des Wettbewerbs
für nationale Grenzen,
- Verhinderung der vorrangigen
Behandlung regionaler Anbieter.
Verdingungsordnungen für
freiberufliche Leistungen
Die so
genannte
Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF)
müssen
bei Anbahnung und Abschluss eines Auftrages beachtet werden.
Da die
Ingenieurleistung
keine im Voraus erschöpfend beschreibbare Leistung ist,
geschieht
regelmäßig die Vergabe von Ingenieurleistungen
über die
VOF zu den geregelten Vergabekriterien. Die VOF findet Anwendung auf
die Vergabe von Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen
Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich
Tätigen angeboten werden.
Geistig-schöpferische
Dienstleistungen sind Leistungen, deren wesentlicher Leistungsinhalt in
der Erbringung künftiger geistiger Arbeit besteht, die nicht
zwingend zum selben Ergebnis führt. Für derartige
Leistungen
ist ihrer Art nach zwar eine Aufgabenbeschreibung, nicht jedoch eine
vorherige eindeutige und vollständige Beschreibung der
Leistung,
wie z. B. Produktbereich oder materieller Bereich, möglich.
Diese
Aufgabenbeschreibung ist eine Aufgabenstellung, die zwar für
alle
Bewerber im gleichen Sinne zu verstehen ist, im Endeffekt jedoch zu
einem unterschiedlichen Ergebnis führt.
Sobald eine
Gemeinde oder
Stadtrat einer Ortsumgehung, einer Brücke oder eine
Stadtsanierung
beschlossen hat, ist zu entscheiden, ob es sich um einen Auftrag
oberhalb der EU-Schwellenwerte (200.000 Euro) handelt, der
gemäß VOF abzuwickeln ist.
Sind bei einem
Projekt
unterschiedliche Planungsleistungen nötig (Objektplanung,
Statik
technischer Ausrüstung, Vermessung), kann der
öffentliche
Bauherr mit jedem der Planer einen eigenen Werkvertrag
schließen
(der Auftraggeber koordiniert ihren Projekteinsatz selbst oder
über einen Projektmanager). Die Auftragswerte sind in diesem
Falle
für die einzelnen Planungsleistungen getrennt zu ermitteln.
Soll
andererseits ein Generalplaner
beauftragt werden, der auch die Koordination der Fachplaner
übernimmt, ist die Höhe des Auftragswertes
für dieselbe
freiberufliche Leistung der Höhe der Gesamtvergütung
des
Generalplaners.
Vergabegrundsätze
Vergabegrundsätze sind:
- Leistungs- statt preisbezogener
Wettbewerb,
- Gleichbehandlung aller Bieter,
- Unzulässigkeit unlauterer
und wettbewerbseinschränkender Verhaltensweisen,
- unabhängig von
Ausführungs- und Lieferadressen,
- angemessene Beteiligung kleiner
Büros und von Berufsanfängern.
Am Anfang einer
Vergabe von
Architekten- und Ingenieurleistungen nach VOF steht die Bekanntmachung,
die nötig ist, um einen unbekannten Bieterkreis für
einen
Auftrag zu interessieren.
Genannt werden
müssen in der Bekanntmachung die für die Beurteilung
der Bewerber wichtigen Kriterien, wie:
- Organisationsform,
- Ausschlussgründe,
- Leistungsfähigkeit,
- Qualifikation.
Wichtig sind dabei klare
Auswahlkriterien, die der Vermeidung von Klagen bei der Vergabekammer
dienen, z. B.:
- der Nachweis der
finanziellen und
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
(Bankenerklärungen,
Bilanzen, Umsatzerklärungen),
- der Nachweis der
fachlichen Eignung
durch Berufszulassungen und Berufsqualifikationsnachweise der
Führungskräfte, durch Nachweis gleichwertiger
Leistungen,
Honorare in den letzten drei Jahren,
- personelle/technische
Büroausstattung,
- Angaben zu Projektteam,
Leitung,
- Erteilung
möglicher Unteraufträge.
Qualitätsfaktoren
- wie
z. B. Erfahrung, fachliche Kompetenz, allgemeine und spezielle
Kenntnisse zum Auftragsgegenstand und projektbezogene Referenzen -
haben sich als qualifizierbare und zumindest objektivierbare
Zuschlagskriterien durchgesetzt.
Referenzen sind
zwar
vergangenheitsorientiert, bieten aber wertvolle Anhaltspunkte, welche
Leistung der Auftraggeber vom potenziellen Auftragnehmer erwarten kann.
Ein
wesentlicher Aspekt im
Rahmen einer gesamtheitlichen Vergabebetrachtung ist, dass der Teil der
Planungskosten an den gesamten Herstellungskosten des Bauwerks
lediglich zwischen 8 und 15 % beträgt. Die Planung selbst
beeinflusst wiederum zu 80 bis 90 % die Herstellungskosten und zu 40
bis 50 % die Betriebskosten. Diese Zahlen sollen verdeutlichen, mit den
fatalen Auswirkungen eine kurzsichtige Vergabepolitik zur Folge haben
kann.
Bund,
Länder und
Gemeinden sind zur Anwendung dieser Richtlinien bzw. der VOF
verpflichtet, sobald 50 % und mehr des zu vergebenden Auftrages mit
öffentlichen Mitteln finanziert werden.
Zukünftige Entwicklung und
Tendenzen im EU-Vergabewesen
Im Jahr 2000
hat die
EU-Kommission einen Vorschlag vorgelegt, durch den die bisher
getrennten Richtlinien zur Vergabe von Bau-, Liefer- und
Dienstleistungsaufträgen in einer Richtlinie zusammengefasst
werden sollen. Wesentliche Zielsetzung des Vorschlages ist die
Vereinfachung, Modernisierung und Flexibilisierung der bisherigen
Regelungen. Diese Richtlinien könnten bis Mitte des Jahres
2004
umgesetzt und verabschiedet werden. Auch ein komplettes Scheitern des
Vorhabens ist noch immer möglich.
Wesentliche inhaltliche
Änderungen
Einführung
elektronischer Beschaffungsmechanismen
Auf Basis der
rasanten
Entwicklung der neuen Informations- und Kommunikationstechniken hat
sich die Kommission zum Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2004 auf
nationaler und europäischer Ebene 25 % aller
öffentlichen
Aufträge auf elektronischem Wege vergeben werden.
Einführung des
wettbewerblichen Dialogs (eine zusätzliche Art des
Verhandlungsverfahrens)
Bei besonders
komplexen
Aufträgen kann es für den Auftraggeber objektiv
unmöglich sein, die Mittel für seine
Bedürfnisse zu
definieren oder zu beurteilen, welche technischen oder finanziellen
Lösungen der Markt zu bieten hat. Es soll daher für
den
Auftraggeber die Möglichkeit eröffnet werden,
einzelne
Angebote in die engere Wahl zu nehmen, wobei die Honorierung und die
Urheberrechte bisher nicht gesichert sind.
Die
Bundesingenieurkammer hat bisher dieses Verfahren unter dem
Gesichtspunkt der Diskriminierung abgelehnt.
Erhöhung der
Schwellenwerte
Die
Schwellenwerte für
die Anwendung der Richtlinienvorschriften sollen um über 20%
erhöht und für Dienstleistungsaufträge und
Wettbewerbe
angeglichen werden, um eine Diskriminierung von Wettbewerben zu
vermeiden.
Flexiblere Beschaffung durch
Rahmenvereinbarungen
Für
Beschaffungsvorgänge in Märkten, die sich
ständig
ändern, aber auch für geistig-schöpferische
Dienstleistungen, die im Laufe eines bestimmten Zeitraumes
benötigt werden, soll dem Auftraggeber die
Möglichkeit einer
Rahmenvereinbarung eingeräumt werden.
2. EU-Diplom
Berufsanerkennungsrichtlinie
Zu einer der
wichtigsten
rechtlichen Voraussetzung für den Marktzugang polnischer
Ingenieure nach Deutschland zählt die Anerkennung der Diplome.
In
Polen werden ausländische Bildungsabschlüsse
anerkannt, wenn
ein entsprechendes bilaterales Abkommen über die gegenseitige
Anerkennung von Hochschulabschlüssen mit dem Herkunftsland
vorliegt bzw. auch auf dem Wege der Nostrifizierung. Im Falle
Deutschland liegt zwar ein entsprechendes Abkommen von 1998 vor, nur
ist dadurch die Anerkennung von Bildungsabschlüssen und
Berufsbezeichnungen lediglich für akademische Zwecke
vereinbart,
nicht jedoch zur Berufsausübung.
Das Abkommen
legt eindeutig
fest, dass zur Arbeitsaufnahme eine Nostrifizierung der
Berufsabschlüsse bzw. Diplome notwendig ist.
Zuständig sind
hier die Hochschulfakultäten oder die entsprechenden
Berufskammern.
Für
bilaterale Abkommen
hinaus erkennt Polen aber auch multilaterale und staatliche
Vereinbarungen an. So ist die polnische Förderation der
wissenschaftlich-technischen Verbände/Obere technische
Organisation als Dachorganisation verschiedener polnischer
Ingenieurverbände seit 1992 Mitglied der FEANI (Federation
Europeenne de Associations Nationale de 'Ingenieurs).
Der deutsche
Titel
"Diplomingenieur" bzw. "Ingenieur" ist in diesen Fällen den
polnischen Titel "Magister Ingenieur" bzw. "Ingenieur" gleichgestellt
und eine Nostrifizierung nicht mehr notwendig.
EU-rechtliche Grundlagen
Die Abschaffung
der zwischen
den Mitgliedsstaaten stehenden Hindernisse für die
Freizügigkeit der Personen im Allgemeinen und der
Dienstleistungserbringer im Besonderen ist eines der wichtigsten Ziele
des Vertrages von Rom zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft.
Im Bereich der
Anerkennung der beruflichen Qualifikationen wurden mehrere Richtlinien
verabschiedet.
Der erste
Ansatz war
vertikal, "d. h. nach Berufen ausgerichtet." Die sektoriellen
Richtlinien, die zwischen 1975 und 1985 angenommen wurden, betreffen
insbesondere Ärzte und Architekten.
Der neue
horizontale Ansatz
führte zur Verabschiedung der Richtlinien zur Anerkennung der
Hochschuldiplome, die eine mindestens 3-jährige
Berufsausbildung
abschließen (89/48 EWG). Diese Richtlinien umfassen alle
reglementierten Berufe, die nicht Gegenstand einer
Übergangsrichtlinie oder einer sektoriellen Richtlinie sind.
Dies
trifft auch auf den Ingenieurberuf zu, wenn dieser Beruf im
Mitgliedsstaat reglementiert ist, in dem der ausgeübt werden
soll
(Aufnahmemitgliedsstaat). Normalerweise fällt der
Ingenieurberuf
unter die Richtlinie 89/48 EWG.
Als
reglementiert im
Sinne der Richtlinien gilt ein Beruf, bei dem die Aufnahme oder
Ausübung der Tätigkeit durch Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten von bestimmten beruflichen
Qualifikationen abhängig ist. Wenn der Beruf im
Aufnahmemitgliedsstaat nicht reglementiert ist, muss die Anerkennung
der Qualifikationen nicht beantragt werden, weil kein rechtliches
Hindernis für die Aufnahme der beruflichen Tätigkeit
besteht.
Anerkennung von Berufsqualifikationen
Der
Richtlinienvorschlag vom
März 2002 hat zum Ziel, das EU-System der Anerkennung von
Berufsqualifikationen zu vereinfachen und Hindernisse bei der
Ausübung von Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit zu
beseitigen. Vorgeschlagen wird hier, dass sämtliche sektoralen
Richtlinien als Architekten und andere mit den Richtlinien, die das
allgemeine Anerkennungssystem bilden, d. h. auch für
Ingenieure,
Stadtplaner, Landschafts- und Innenarchitekten, sowie für
gewerbliche und Handwerksberufe in einem Richtlinienentwurf zu
konsolidieren. Dieser Entwurf, der im Jahr 2004 verabschiedet werden
soll, beinhaltet eingehende Regelungen zum Dienstleistungsverkehr sowie
zur Niederlassung in EU-Mitgliedsstaaten.
Der
Berichterstatter im
Europaparlament, ein italienischer Ingenieur, hat gegen den
erklärten Widerstand der Kommission vorgeschlagen, ein
neues Kapitel für Ingenieure nach dem Muster der Regelungen
für Architekten einzuführen.
Die Bundesingenieurkammer unterstützt, wie auch der neu
gegründete Ingenieurdachverband ECEC, dieses Ziel.
Voraussetzung
für ein solches sektorales Kapitel ist jedoch, dass der
Berufsstand es schafft, es hinsichtlich der Anerkennung zu Grunde zu
legenden quantitativen und qualitativen Kriterien der Ausbildung auf
einen kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen. Ab 2004 ist auch Polen
mit allen Rechten am Gesetzgebungsverfahren beteiligt.
3. EU-Binnenmarktstrategie
für den Dienstleistungssektor
Die EU hat
erkannt, dass
Dienstleistungen mehr und mehr zum Motor der europäischen
Wirtschaft werden. Der Grund des aktuellen Richtlinienentwurfes der
Kommission ist, dass eine Verbesserung der Rahmenbedingungen
für
die EU-Dienstleistungswirtschaft dringend notwendig sei, um die
Wachstumsschwächen in der EU zu überwinden. Da zwei
Drittel
der Exporte in die EU gehen, sei die Schaffung eines
unbürokratischen und wettbewerbsfördernden
Binnenmarktes
für Dienstleistungen in der EU von höchster
Priorität.
Hiervon
betroffen sind auch
die freien Berufe, d. h. auch Architekten und Ingenieure. Wesentliche
Bestandteile des Entwurfs der Rahmenrichtlinien sind
Dienstleistungsfreiheit, Qualitätssicherung und Garantien,
Aufsicht, Konvergenzrahmen und Inkrafttreten.
Niederlassungsfreiheit
Ziel ist hier die
Verwaltungsvereinfachung und der Bürokratieabbau, hierzu
folgende Methoden:
- Durchforstung
von Genehmigungserfordernissen auf der Ebene der Mitgliedsstaaten
Anzustreben seien Genehmigungskriterien, die gesetzlich vorgeschrieben
werden und keinen Ermessensspielraum mehr für die
Behörden
zulassen. Prozeduren für Dienstleistungserbringer, eine
Genehmigung zu erhalten, sind oft nur schwer zu durchschauen.
- Verfahrensbeschleunigung
Deshalb sollen die Verfahren beschleunigt (Mindestfristen,
Informationserleichterung), vereinfacht (weniger Dokumente) und fair
gestaltet (transparent, objektiv)
werden durch:
- einheitliche
Anlaufstellen,
- einheitliche
Formulare in eigener Verantwortung der Mitgliedsstaaten, meist durch
Kommunen, Kammern und Verbände.
In zunehmendem
Maß
sollen auch elektronische Genehmigungsverfahren praktiziert werden. Als
Ergebnis soll erreicht werden, dass sich alle Mitgliedsstaaten
verpflichten, einen bestimmten Kanon von Dokumenten gemeinschaftsweit
anzuerkennen. Abgeschafft werden soll z. B. eine Liste, die
Erfordernisse enthält, die mit dem Gemeinschaftsrecht nicht
vereinbar sind (Staatsangehörigkeit, Wohnsitz,
Bedarfsprüfung
u. a.).
In Bezug auf
die
Dienstleistungsfreiheit geht es darum, das Herkunftslandprinzip zu
verankern, wenn ein Unternehmen in einem Mitgliedsstaat legal
tätig ist, dann soll es ohne Zusatzaufwand auch in anderen
Mitgliedsstaaten eine Tätigkeit aufnehmen können.
Dazu sollen zwei Aktionslinien
verfolgt werden:
- Mindestharmonisierung von
Rahmenbedingungen, wie z. B. ein Informationspaket, das alles
geforderten Genehmigungen / Bestätigungen enthält.
Informationsdienste, die Auskunft auf Anfrage erteilen, bei
Dienstleistungen mit besonderem Risiko soll die Verpflichtung zum
Abschluss von Haftpflichtversicherungen vorgeschrieben werden.
- Für
Werbebeschränkung, z. B.
für den Ingenieurberuf, sollen Mindeststandards (keine
Totalverbote) festgelegt werden.
Darüber
hinaus sollen
Vorschläge für EU-weite Verhaltensregelungen,
Mindeststandards für die Zulassung multidisziplinärer
Partnerschaften, zügige und vereinfachte
Konfliktbeilegungsverfahren sowie Informationsaustausch über
die
jeweiligen Dienstleistungsanbieter gemacht werden.
Bei
grenzüberschreitender Zusammenarbeit zwischen
Verwaltungsbehörden und Kammern müssen die
entsprechenden
Voraussetzungen geschaffen werden, möglichst schnell und
effizient
Informationen über die Berufsangehörigen im
Herkunftsland zu
beschaffen und bei Fehlverhalten eine Nachverfolgung durch die
Behörden im Herkunftsland zu ermöglichen. Die
Verabschiedung
dieser Richtlinien ist bis Ende 2005 vorgesehen, Umsetzungstermin ist
Ende 2007/2008. Ziel ist, dass insbesondere den Berufskammern
im
Rahmen dieser Richtlinie als so genannte One-Stop-Shop als einzige
nationale Anlaufstelle besondere Bedeutung zukommen solle.
Anpassung der
Sozialversicherungssysteme in Europa
Im Juli 2003
hat die
EU-Kommission einen Vorschlag über Vereinfachung und
Modernisierung der Sozialversicherungssysteme vorgelegt. Ziel der
Verordnung ist, die grenzüberschreitenden Aspekte der
nationalen
Sozialversicherungssysteme zu koordinieren, die durch vielfache
Veränderungen in den letzten Jahren zu überladen und
schwerfällig geworden waren. Personen, die innerhalb der EU
ihren
Aufenthaltsort wechseln, d. h. polnische Ingenieure in Deutschland
tätig werden und umgekehrt, sollen nicht schlechter stehen als
diejenigen, die ständig an einem und demselben Ort leben und
arbeiten. Dies kann nur sichergestellt werden, wenn die nationalen
Sozialversicherungssysteme einheitlich angewendet und nicht an
Nationalität, sondern lediglich an eine
EU-Bürgerschaft
geknüpft werden.
II. Nationale Rahmenbedingungen
Ingenieurkammergesetze der
Länder
Gestern, am
11.12.2003, hat
die Wirtschaftsministerkonferenz der Länder, ein so genanntes
Musteringenieurkammergesetz verabschiedet und den 16
Bundesländern
zur Umsetzung empfohlen. Hintergrund des Beschlusses sind die 16
divergierenden Ingenieurgesetzte und 16 Ingenieurkammergesetze, die
nunmehr zusammengefasst werden.
Folgende wichtige
Harmonisierungseckpunkte sind Gegenstand dieses Gesetzes:
- Die Dauer der erforderlichen
praktischen Tätigkeit als Eintragungsvoraussetzung wird
einheitlich auf drei Jahre festgesetzt.
- Die Regelung zur Werbung wurde
vereinheitlicht.
- Eine engere Zusammenarbeit zwischen
den Kammern im Architekten- und Ingenieurbereich soll erreicht werden.
- Architekten und Ingenieure sind
Kapitalgesellschaften unter Führung ihres Titels
eröffnet
bzw. erleichtert worden, um dem zunehmenden Interesse dieser
Berufsgruppen einer Gründung von mono- und
interprofessionellen
Kapitalgesellschaften gerecht zu werden.
- Eine Unterscheidung von
Pflichtmitgliedern und freiwilligen Mitgliedern findet nicht mehr
statt. Allerdings bleibt die Frage, ob bauvorlageberechtigte Ingenieure
per se Mitglieder bzw. Pflichtmitglieder einer Kammer sind, der
künftigen Ländergesetzgebung überlassen.
Ähnlich
wie das
polnische Gesetz vom 15.02.2000 für die Berufsverwaltung der
Architekten, Bauingenieure und Stadtplaner wird nicht nur der
organisatorische Aufbau der Kammern und ihrer Kompetenzen geregelt,
sondern auch die Rechte und Pflichten ihrer Mitglieder.
Berufshaftpflichtversicherung
Wegen der
besonderen
Bedeutung, die der Verbraucherschutz in Verbindung mit einer gesetzlich
geschützten Berufsbezeichnung hat, wird für Beratende
Ingenieure in Gesellschaften das Erfordernis gesehen, eine
Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen. Die
Mindestversicherungssumme beträgt für jeden
Versicherungsfall
1,5 Mio. Euro für Personenschäden und 300.000 Euro
für
Sach- und Vermögensschäden. Die Ingenieurkammer
überwacht das Bestehen eines ausreichenden
Versicherungsschutzes.
|